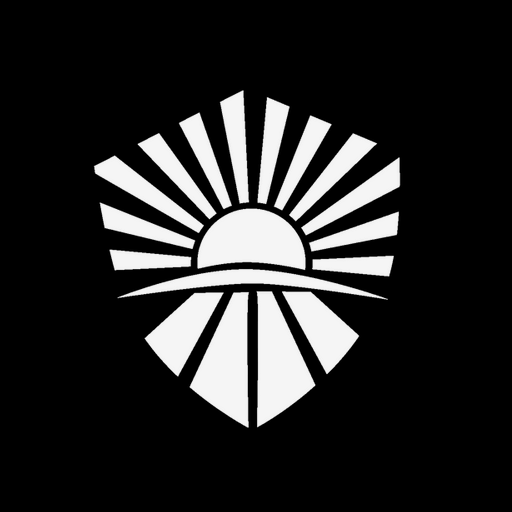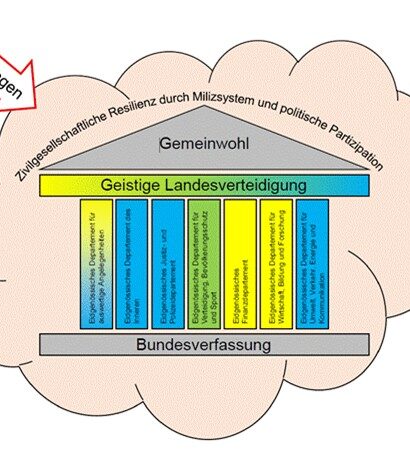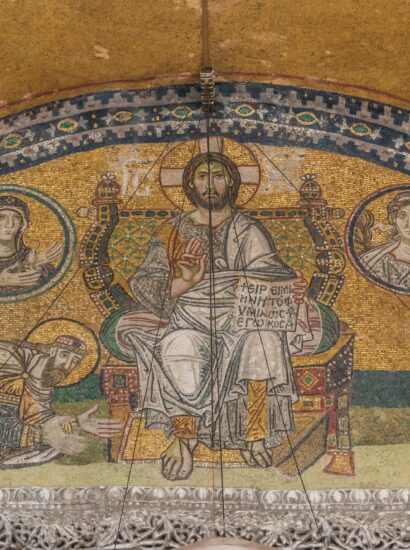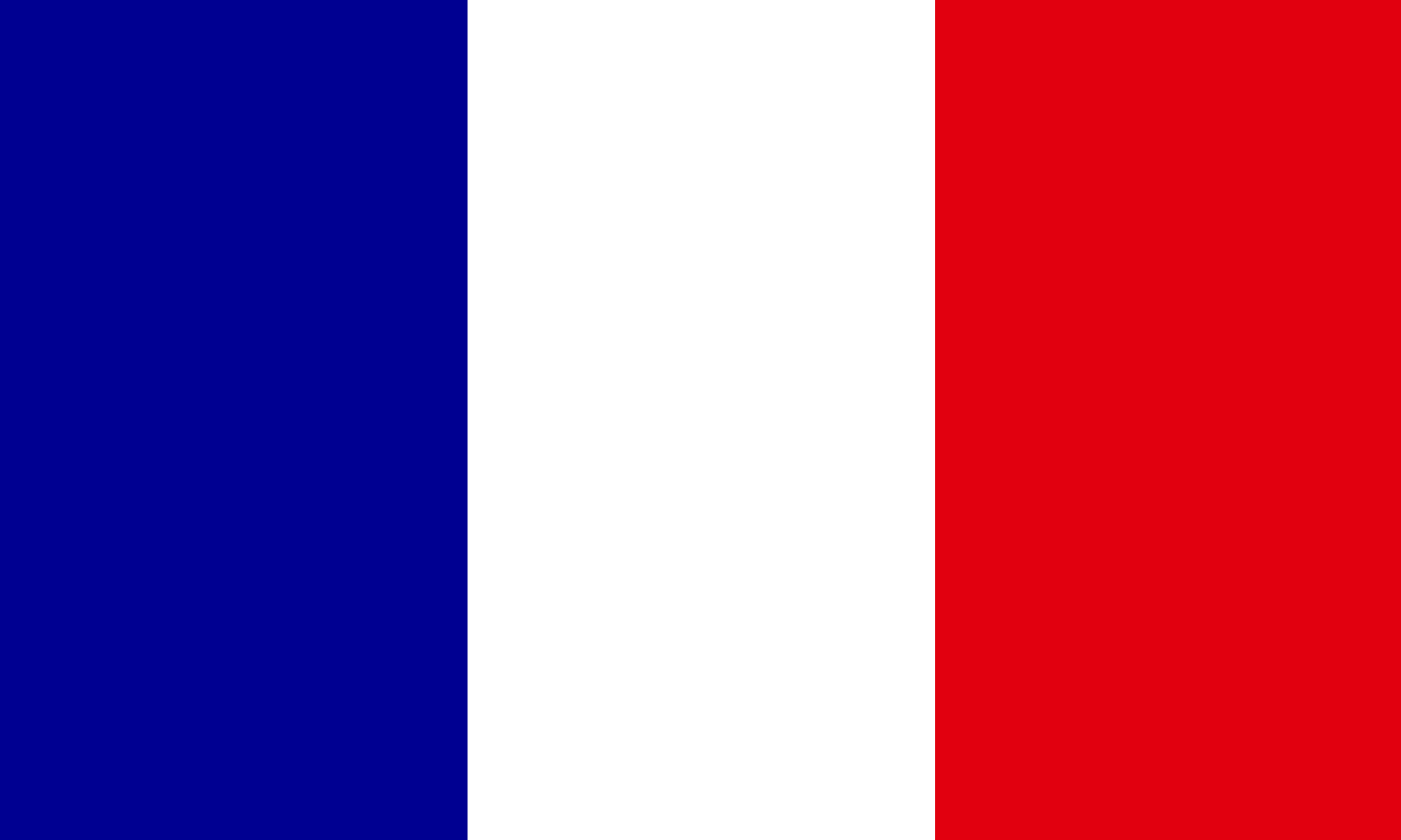Abstract: Die Taktikausbildung im Österreichischen Bundesheer (ÖBH) war in den letzten Jahrzehnten von der Idee des Manövers geprägt. Sämtliche Lösungen für taktische Herausforderungen haben sich daher am Manöver orientiert. Das Manöver hatte zum Ziel, eine eigene Überlegenheit aufgrund Beweglichkeit und Überraschung zu erreichen. Dieses Dogma wurde auch dem gegnerischen Verhalten zu Grunde gelegt. Spätestens seit Beginn des aktuellen Krieges in der Ukraine muss jedoch von einem „gläsernen Gefechtsfeld“ ausgegangen werden, welches das überraschende Auftreten von Streitkräften sehr erschwert hat. Ein weiterer Aspekt ist der massive Einsatz von Steilfeuer, geleitet mittels Drohnen, wodurch sichere Rückzugs- beziehungsweise Bereitstellungsräume praktisch verschwunden sind.
Problemstellung: Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, um das Manöver wieder zu ermöglichen?
Was nun?: Als unmittelbare Konsequenz sind sämtliche Schulungslagen am Institut für Offiziersweiterbildung anzupassen. Das gegnerische Verhalten muss sich an den neu verfügbaren Opposing Force (OPFOR)-Unterlagen der Landesverteidigungsakademie und an eigenen Beobachtungen und Auswertungen des Referats Taktik und Stabsdienst orientieren. Der entscheidende Faktor dabei ist, eine Überlegenheit des Gegners zu akzeptieren und nicht mehr länger mit unterlegenen oder in der Fähigkeit beschränkten Feindgruppierungen zu arbeiten. Ziel muss es sein, die Offiziere des Österreichischen Bundesheeres an diese Tatsache zu gewöhnen. Erst wenn Stabsoffiziere, als militärische Planer:innen und Kommandant:innen, als Führer:innen des laufenden Gefechts, diese Tatsache akzeptiert und berücksichtigt haben, werden erfolgreiche eigene Gefechtsideen möglich. Der entscheidende Faktor ist dabei die schonungslose Darstellung gegnerischer Effekte, um Schwächen in der eigenen Planung und Gefechtsführung aufzudecken. Eine Inkaufnahme des kontrollierten Scheiterns der Übungstruppe ist notwendig, um das gewünschte Umdenken zu erreichen.

Source: shutterstock.com/Getmilitaryphotos
Methoden in der Taktikausbildung
Das Manöver in seiner bisherigen Form führt nicht mehr zum gewünschten Erfolg auf dem Gefechtsfeld! Das Manöver, im Sinne der weitläufigen (Angriffs-)Bewegung großer Verbände, wurde im zweiten Irakkrieg (2003) erfolgreich angewandt und diente als Maßstab für die Taktik von Landstreitkräften. Unter anderem leiteten sich daraus die Tagesleistungen einer Brigade im Angriff von bis zu 60 km ab.[1] Mit diesem Wissen wurde auch der Beginn des Angriffs auf die Ukraine beobachtet. Es wurde jedoch sehr rasch ersichtlich, dass diese Form des Manövers nicht verwirklicht werden konnte und es über die Zeit sogar zu einer Art Stellungskrieg kam. Wenn man nun also die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine betrachtet,[2] so kommt man nicht umhin, sich die Frage zu stellen, worin die Gründe dafür liegen. Viel wichtiger als die Beantwortung dieser Frage ist das Ziehen von Ableitungen für die Ausbildung im Österreichischen Bundesheer, insbesondere am Institut für Offiziersweiterbildung der Theresianischen Militärakademie (TherMilAk).
Die Taktikausbildung im ÖBH war in den letzten Jahrzehnten von der Idee des Manövers geprägt. Sämtliche Lösungen für taktische Herausforderungen haben sich daher am Manöver orientiert, ermöglicht durch die aktive Nutzung des Kampfes der verbundenen Waffen. Das Manöver hatte zum Ziel, eine eigene Überlegenheit aufgrund Beweglichkeit und Überraschung zu erreichen.[3] Dem Übungsgegner wurde während des Kalten Krieges die Militärdoktrin und die Ausrüstung der ehemaligen Sowjetunion zugrunde gelegt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde der Übungsgegner durch paramilitärisch handelnde Konfliktparteien ergänzt und auch ersetzt. Es wurden Szenarien entwickelt, welche in einem fiktiven Ausland spielten, um über den internationalen Kontext eine Rechtfertigung für das eigene Handeln und die Auseinandersetzung mit robusten militärischen Konflikten zu erlangen. Diese fiktiven, nicht von der militärischen Landesverteidigung abgeleiteten, Szenarien erlaubten es dem Lagenersteller, sich den Übungsgegner anzupassen. Unter dem Argument der Manöverfokussierung kamen stets in der Kampfkraft und in den Fähigkeiten unterlegene Feindgruppierungen zur Anwendung. Dadurch konnte man im ÖBH fehlende Fähigkeiten wie Pionierkampfunterstützung, Luftunterstützung oder Fliegerabwehr marginalisieren. Dieses Phänomen trat verstärkt bei Planspielen auf, da in diesem Falle nicht einmal der (Übungs-)Wahrheitsbeweis für das eigene Handeln anzutreten war.[4]
In der praktischen Ausgestaltung von Übungen wurde meist aus Gründen der Einfachheit ein „Dogfight-Szenario“ gewählt,[5] womit die oben dargestellte Negativspirale weiter beschleunigt wurde. Dabei handelt es sich um zwei militärische Gruppierungen, welche über dieselben Fähigkeiten und dieselbe Doktrin verfügen, mit aufeinandertreffenden Planungsstäben, die gleich ausgebildet waren. Die Parteien verfügten aber in der Regel nicht über den vollen Umfang an Fähigkeiten, wie sie mittlerweile State of the Art sind. Als Beispiel wären hier Drohnen für Aufklärung und Steilfeuerbeobachtung anzuführen. Auch die Unterstützung durch Luftstreitkräfte beziehungsweise Heeresfliegerkräfte und die notwendigen Fliegerabwehrmaßnahmen wurden oft aus Gründen der „Einfachheit“ vernachlässigt.[6] Der Grund dafür lag in der Aufwandreduktion für die Übungsvorbereitung und -steuerung.
In der praktischen Ausgestaltung von Übungen wurde meist aus Gründen der Einfachheit ein „Dogfight-Szenario“ gewählt, womit die oben dargestellte Negativspirale weiter beschleunigt wurde.
Diese Art der Übungsanlage wurde auch im Sinne einer Denkschule des Manövers verwendet. Es hatte üblicherweise jene Partei Erfolg, welche das Manöver schneller und überraschender zur Anwendung brachte.[7] Über die Jahre wurde diese Denkschule trotz aktueller Kriegsbeispiele schleichend in die Anlage sämtlicher Übungen übernommen, da das Militär den (tages-)politischen Narrativ übernommen hat.[8] Das in der Theorie gelehrte Gefechtsbild,[9] wie beispielsweise das Angriffsverfahren des ehemaligen Warschauer Paktes,[10] wurde so gut wie nie von einem Übungsgegner vollzogen. Egal um welche Übungsform es sich handelte, der Übungsgegner wurde immer aus Soldat:innen gebildet, welche über eine vergleichbare Ausbildung und Erfahrung verfügen.
Das Dilemma am Institut für Offiziersweiterbildung
Verstärkend wirkte am Institut für Offiziersweiterbildung der Faktor der Auswertung der Lehrgangsevaluierungen. Die Evaluierung und die Umsetzung der Ergebnisse ist eine notwendige und sinnvolle Maßnahme zur Qualitätssicherung. In Wahrheit stellt sie jedoch auch eine Art Falle dar, in die das Lehrpersonal leicht tappt.[11] Als Institution wurde danach getrachtet, negative Rückmeldungen zu kompensieren beziehungsweise zu vermeiden. In letzter Konsequenz bedeutete dies, dass bei Übungen die eigenen Kräfte zwingend erfolgreich sein mussten. Ein Scheitern hätte sonst zu Frustration bei den Lehrgangsteilnehmer:innen und damit verbunden zu negativen Kritiken führen können. Als Organisation ist es also umso wichtiger, zu erklären, zu welchem Zweck die Auszubildenden im Rahmen eines kontrollierten Scheiterns in eine bewusste Überforderung geführt werden. Da damit einhergehende negative Kritiken im Rahmen der Evaluierung nicht ausgeschlossen werden können, muss die Fragestellung entsprechend angepasst werden. Im Zuge der Auswertung der Evaluierung ist dann klar abzugrenzen, welche Teile negativ wahrgenommen werden.
Veränderte Rahmenbedingungen
Die Hauptaufgabe im Institut für Offiziersweiterbildung liegt sinngemäß darin, die Offiziere für ihre Aufgabe in einem Krieg zu befähigen.[12] Der Krieg und damit das konventionelle Gefecht kehrte mit Beginn des aktuellen Krieges in der Ukraine (2022) in die Wahrnehmung zurück und darf jetzt auch wieder ohne Umschweife ausgebildet werden.[13]
Eine kritische Reflexion der beobachteten Ereignisse führte zu zwei Ergebnissen. Einerseits wurde das Lehrskriptum der Landesverteidigungsakademie (LVAk) „OPFOR konventionelle Landstreitkräfte, Gefechtsaufgaben und Gliederungen“,[14] und damit die Beschreibung der gegnerischen Ausrüstung und Verfahren, angepasst. Andererseits kann das „gläserne Gefechtsfeld“ nicht mehr länger unbeachtet bleiben. Die Verwendung von Drohnen zur Aufklärung, Steilfeuerbeobachtung und aktiven Bekämpfung stellt eine technische Evolution des Gefechts dar. Ein überraschendes Auftreten von Streitkräften wurde praktisch unmöglich gemacht.[15] Ein weiterer Aspekt ist der massive Einsatz von Steilfeuer. Wir beobachten eine durch den Westen völlig unterschätzte Intensität der Verwendung von Artillerie.[16] Durch die Summe dieser Effekte sind sichere Rückzugs- beziehungsweise Bereitstellungsräume praktisch verschwunden.
Die Verwendung von Drohnen zur Aufklärung, Steilfeuerbeobachtung und aktiven Bekämpfung stellt eine technische Evolution des Gefechts dar.
Obwohl diese Beobachtungen und Erkenntnisse eine wesentliche Grundlage für eine weitere Entwicklung der Taktik darstellen, dürfen sie nicht isoliert betrachtet werden. Es muss in einer selbstkritischen Reflexion festgestellt werden, dass über die Jahrzehnte verschiedene Dinge vergessen wurden und im Rahmen der Überarbeitung von Dienstvorschriften daraus entfernt worden sind. Als Beispiel dafür kann die Dienstvorschrift für das Bundesheer „Truppenführung“ genannt werden. In der Fassung aus 1965[17] wird noch auf das Angriffsverfahren eines überlegenen Feindes eingegangen, während die aktuelle Fassung aus 2004 keine Aussagen zu einem möglichen Feindverhalten mehr trifft. Anhand dieses Beispiels lässt sich also erkenne, dass ein überlegener feindlicher Steilfeuereinsatz in Vergessenheit geraten und erst im Zuge der Auswertungen des Ukrainekrieges wieder in unser Bewusstsein getreten ist. Um eine ganzheitliche Problemanalyse als Grundlage für das Ziehen der richtigen Folgerungen machen zu können, sind drei Aspekte notwendig. Diese sind die Beobachtung des aktuellen Verhaltens realer Konfliktparteien („Reconnoitre“), das Überprüfen aktueller Dienstvorschriften auf Plausibilität und das inhaltliche Vergleichen mit außer Kraft gesetzten Versionen („Revise“), und letztendlich das Wiedererlernen von immer noch gültigen Verhaltensweisen und Abläufen („Relearn“). Die Neukontextualisierung der Dienstvorschriften unter Anwendung der „Operational Capabilities Research Methodology“[18] kann durchaus als Gebot der Stunde bezeichnet werden.
Ziel muss es sein, die Offiziere des Österreichischen Bundesheeres an die Tatsache zu gewöhnen, dass der Gegner über zum Teil überlegene Fähigkeiten verfügt und diese auch zu nutzen im Stande ist. Erst wenn diese Tatsache akzeptiert wurde, können die eigenen Stärken gegenübergestellt werden und erfolgreiche eigene Gefechtsideen entwickelt werden.
Simulationsgestützte Führungsübungen sind dazu besonders geeignet. Systeme wie der „Combined Arms Tactical Trainer (CATT)“ oder Ähnliches lassen eine Überprüfung der Gefechtsideen zu und ermöglichen eine evolutionäre Weiterentwicklung des Manövers. Der entscheidende Faktor ist dabei die schonungslose Darstellung gegnerischer Effekte um Schwächen in der eigenen Planung und Gefechtsführung aufzudecken. Eine Inkaufnahme des kontrollierten Scheiterns der Übungstruppe ist notwendig, um das gewünschte Umdenken zu erreichen.[19]
Systeme wie der „Combined Arms Tactical Trainer “ oder Ähnliches lassen eine Überprüfung der Gefechtsideen zu und ermöglichen eine evolutionäre Weiterentwicklung des Manövers.
Neue Ansätze
Das Manöver, wie es in den letzten 20 Jahren verstanden wurde, ist nicht mehr länger der Schlüssel zum Erfolg. Es muss ein Umdenken beziehungsweise eine adaptierte Anwendung von Grundsätzen erfolgen. Betrachtet man zum Beispiel die Thematik der Tarnung und Täuschung im Sinne des Führungsgrundsatzes „Überraschung und Täuschung“,[20] welcher unverändert notwendig und in adaptierter Form auch weiterhin erfolgversprechend ist, so kann ein Gegner durch Überfrachtung seines Common Operational Pictures mit hunderten falsch positiven Signalen überfordert werden, wodurch die Fähigkeit zur effektiven Zielbekämpfung deutlich reduziert werden kann.[21]
Das Institut für Offiziersweiterbildung hat daher einen neuen Ansatz gewählt, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Es werden die Erkenntnisse aus dem IRON NIKE-Forschungsprogramm in der Lehre umgesetzt. Die Digitalisierung der Stabsarbeit erfolgt unter Nutzung vielfältiger Visualisierungstechnologien der Extended Reality in einem Digitalen Hauptquartier (DHQ), in dem durch rasche Datenintegration und Visualisierung (RADIV) eine immersive und kollaborationsfähige, dreidimensionale Planungsumgebung bereitgestellt wird. Durch das förmliche Eintauchen in den virtuellen Einsatzraum werden die Wahrnehmung der Bearbeiter:innen unterstützt und Entscheidungsfindungsprozesse durch bessere Einblicke qualitativ verbessert.[22] Neben der Vermittlung neuer Methoden in der Planung von Einsätzen kommt der Ergebnisüberprüfung unter Nutzung simulationsgestützter Übungen (wie oben dargestellt) eine wesentlich höhere Bedeutung zu. Weitere neue Ansätze sind die vermehrte Anwendung von Case Studies, wo eine kritische Auseinandersetzung mit einem aktuellen Kriegsbeispiel erfolgt. Der Benefit entsteht dabei durch die Diskussion der Erkenntnisse und möglicher alternativer Lösungsansätze. In der Vermittlung der Taktik werden zusätzlich die Möglichkeiten der Fernlehre genützt. So kann der Lernende im Sinne von Microcredentials sein taktisches Verständnis und Handwerkszeug verbessern. Zusätzlich sollte über die leihweise Zurverfügungstellung von CATT-Lizenzen seitens der TherMilAk nachgedacht werden. Damit würden die Lernenden in die Lage versetzt werden, Planungsergebnisse überprüfen zu können. Durch das Lehrpersonal des Instituts für Offiziersweiterbildung könnte dann auch eine individuelle Ergebnisrückmeldung erfolgen, welche dem Lernfortschritt zugutekommen würde. Im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung gewinnt der Bereich des Military Leaderships, unter Einbindung internationaler Experten, zunehmend an Bedeutung. Sämtliche Maßnahmen, inklusive der angewandten Forschung zur Zukunft der Stabsarbeit, dienen dazu, Bilder zur Realität des Gefechts zur Verfügung zu stellen, und der bestmöglichen Vorbereitung auf die Aufgabenwahrnehmung![23]
Das ÖBH muss sich neben dem personellen Aufwuchs und dem Aufbau neuer beziehungsweise verloren gegangener Fähigkeiten auch mit allfälligen Änderungen in der Ausbildung auseinandersetzen. Ein Teil davon ist die Evaluierung der Taktikausbildung. Der Fokus liegt dabei weniger auf revolutionären Neuerungen, sondern mehr auf der evolutionären Anpassung, wie Jim Storr sie mit folgenden Worten beschreibt:
„(…) But if you are a western country, you can continue as you currently do. You have good people. You might not have the right ones in the right places. The best of them are not trained well enough. You use too many of them in headquarters which are too big, too vulnerable, and too busy. They produce orders which are too long, and take too long to do so (…).”[24]
Das Institut für Offiziersweiterbildung ist sich seiner Verantwortung um das Humankapital des ÖBH bewusst und leistet den dazu erforderlichen Beitrag im Sinne der Anwendung einer forschungsbasierten Lehre!
Oberst des Generalstabsdienstes Reinhard Janko MA, Referatsleiter Taktik und Stabsdienst am Institut für Offiziersweiterbildung der Theresianischen Militärakademie. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und stellen nicht die Meinung der Theresianischen Militärakademie dar.
[1] Bundesministerium f. Landesverteidigung, Merkblatt für das ÖBH, Handakt Taktik (Stand September 2016), Wien, 2016, 99
[2] ObstdG Dr. Markus Reisner, https://www.bundesheer.at/aktuelles/detail/von-drohnen-und-panzern-zehn-fragen-an-oberst-markus-reisner, zuletzt geändert Mai 15, 2024, abgefragt September 18, 2027.
[3] ObstdG Mag. Dieter Schadenböck, Lehrskriptum der LVAk, Grundlagen der Taktik der Landstreitkräfte 2.0, Wien, 2020: 166-177.
[4] Erfahrung des Verfassers aufgrund dienstlicher Verwendung.
[5] GenMjr iR Mag. Robert Prader, Expertengespräch mit dem Lehrpersonal Referat Taktik&Stabsdienst am Institut für Offiziersweiterbildung der TherMilAk, Wiener Neustadt, Dezember 04, 2023.
[6] Erfahrung des Verfasser aufgrund dienstlicher Verwendung.
[7] GenMjr iR Mag. Robert Prader, Expertengespräch mit dem Lehrpersonal Referat Taktik&Stabsdienst am Institut für Offiziersweiterbildung der TherMilAk, Wiener Neustadt, Dezember 04, 2023.
[8] ObstdG Matthias Wasinger PhD, Vom Wesen und Wert des Militärischen, Dissertation, Wien: 2018, 66-67.
[9] ObstdG Mag. Dieter Schadenböck, Lehrskriptum der LVAk, Das Phänomen der russischen Bataillonskampfgruppe (Bataljonnye Takticheskie Gruppy)– ein Diskussionsbeitrag zum modernen Kriegs- & Gefechtsbild, Wien, 2016, 32-36.
[10] Nationale Volksarmee, Gefechtsvorschrift der Landstreitkräfte, Bataillon und Kompanie, DV 325/0/001, DDR, Potsdam: 1984, 52-84.
[11] ObstdG Dr. Peter Hofer, Klausur des Instituts für Offiziersweiterbildung der TherMilAk, Wiener Neustadt, April 02, 2024.
[12] ObstdG Dr. Peter Hofer, Institutsbefehl für die Ausbildung 2024, Institut für Offiziersweiterbildung/TherMilAk, Wr. Neustadt, April 02, 2024.
[13] ObstdG Dr. Peter Hofer, Offiziersweiterbildung 2030, Jahrbuch 2023 der TherMiAl, Bundesministerium für Landesverteidigung, Heeresdruckzentrum, 1030 Wien, BMLV, HDruckZ 22-00000, Wien 2023, 119-120.
[14] Bundesministerium f. Landesverteidigung, Lehrskriptum des Instituts für Höhere Militärische Führung der Landesverteidigungsakademie: OPFOR konventionelle Landstreitkräfte, Gefechtsaufgaben und Gliederungen, Version 2, Wien: 2016.
[15] ObstdG Dr. Markus Reisner, https://www.bundesheer.at/aktuelles/detail/von-drohnen-und-panzern-zehn-fragen-an-oberst-markus-reisner, zuletzt geändert Mai 15, 2024, abgefragt September 18, 2024.
[16] ObstltdG Georg Stiedl MA, Ausarbeitung Ref Taktik/IHMF/LVAk, Einführung Übungsgegner Rot – konventioneller Kampf, Wien: 2024, Vortrag am Institut für Offiziersweiterbildung, Wiener Neustadt: 30.07.2024
[17] Bundesministierium für Landesverteidigung, Dienstvorschrift für das Bundesheer: Truppenführung (TF), Wien, Juli 1965, 67-69.
[18] ObstdG Dr. Peter Hofer, https://vojenskerozhledy.cz/en/kategorie-clanku/teorie-a-doktriny/improving-urban-operations-capabilities, zuletzt geändert April 04, 2024, zuletzt abgefragt Dezember 02, 2024.
[19] ObstdG Dr. Peter Hofer, Klausur des Instituts für Offiziersweiterbildung der TherMilAk, Wiener Neustadt, April 02, 2024.
[20] OberstdG Mag. Dieter Schadenböck, Lehrskriptum der LVAk, Grundlagen der Taktik der Landstreitkräfte 2.0, Wien: 2020, 83.
[21] Colonel John Antal, US Army (Retired), “The Ten Rules of Masking,” johnantal.com (09.02.2024), 7.
[22] ObstdG Dr. Peter HOFER, “The Quadruplicity of Future Military Command. Urbanization, Digitalization, Artificial Intelligence and Mission Command,” #UOET23 Meeting Proceedings (#UOET Proceedings), https://www.milak.at/en/uoet/uoet23, zuletzt aktualisiert am Januar 17, 2024, zuletzt abgefragt am Dezember 02, 2024.
[23] ObstdG Dr. Peter Hofer, Klausur des Instituts für Offiziersweiterbildung der TherMilAk, Wiener Neustadt, April 02, 2024.
[24] Jim STORR, ”Something Rotten: Land Command in the 21st Century,“ Howgate Publishing Limited, 9.5.22, ISBN-10: 1912440326, 221.